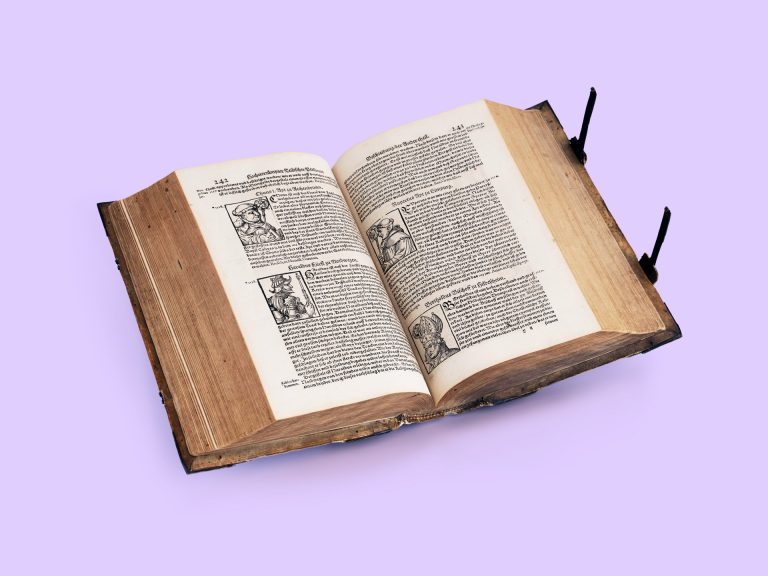Folgen des Ersten Weltkriegs
Die verheerenden Schlachten des Ersten Weltkriegs forderten einen hohen Tribut: Von dreizehn Millionen deutschen Soldaten kamen zwei Millionen ums Leben, etwa drei Millionen kehrten verletzt nach Deutschland zurück. Die hohe Zahl an dauerhaft durch Amputationen körperlich eingeschränkten Menschen sorgte dafür, dass der Bereich der Prothetik stark an Bedeutung gewann.
Während der Weimarer Republik kam es zu wesentlichen Neuentwicklungen, um die Lebensqualität der Kriegsinvaliden zu verbessern. Dabei ging es sowohl um den humanitären Aspekt als auch um wirtschaftliche Gesichtspunkte. Idealerweise gelang es, die Invaliden wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dadurch die finanzielle Belastung für den Staat zu reduzieren.
Ein neues Zeitalter der Prothetik in der Weimarer Republik
Bis zu diesem Zeitpunkt mussten Prothesenträger in der Regel auf sehr simple Hilfsmittel zurückgreifen. Klassischerweise waren dies Holzstelzen als Ersatz für die Beine oder hölzerne wie eiserne Hacken als Handersatz. Ausgefeilte Prothesen standen lediglich Wohlhabenden in Form von Einzelanfertigungen zur Verfügung.
Eine Revolution im Bereich der Prothetik stellte die bewegliche Armprothese des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch aus dem Jahr 1917 dar. Der Sauerbrucharm war nicht starr, sondern ließ sich mit Muskelkraft durch den Prothesenträger bewegen. Dazu formte man aus vorhandenen Muskelsträngen des Unterarms Schlingen und verband diese mit Seilzügen innerhalb der Prothese. Dadurch ließ sich der Greifmechanismus der Prothese steuern.

Nachdem diese Innovation zuerst sehr teuer war, begann ab 1919 der Orthopädietechniker Otto Bock als Erster, Orthopädietechnik in Serie herzustellen. Dazu standardisierte er die einzelnen Bauteile und optimierte so die Produktion. Erst dadurch wurden moderne Prothesen für eine breite Masse erschwinglich. Das Unternehmen Ottobock ist bis heute Weltmarktführer im Bereich der Prothetik.
1922 entwickelte der für Sauerbruch tätige Orthopädietechniker Jacob Hüfner eine mechanische Zweizughand, die Hüfner-Hand. Diese ließ sich mit einem Zugband aktiv öffnen oder schließen und ermöglichte das Greifen von Gegenständen mittels Zangengriffs. Zusätzlich verfügte die Prothese auf der Handinnenfläche über einen Sperrhebel. Mit diesem ließ sich der Zangengriff in jeder beliebigen Stellung fixieren, um Gegenstände dauerhaft zu halten. So war es nicht nötig, beim Halten ständig das Zugband zu spannen und die Muskeln des Prothesenträgers wurden entlastet.
Die Handprothese nach Jacob Hüfner im Deutschlandmuseum
Es sind nur wenige originale Prothesen aus der Frühzeit der Weimarer Republik in gutem Zustand erhalten. Bei dem im Deutschlandmuseum ausgestellten Modell handelt es sich um eine Prothese mit Hüfner-Hand aus den frühen 1920er-Jahren. Die Prothese besteht hauptsächlich aus Holz, Metall und Leder. Sie wurde auf den Unterarmstumpf aufgesteckt, die Stoffpolsterung am Rand der Innenseite sollte die Belastung für den Stumpf reduzieren. Eine Verbindung von Muskelsträngen und Prothese wie bei den Sauerbruch-Modellen war nicht vorgesehen.
Die gummierten Daumen- und Fingerkuppen waren beweglich und per Sperrhebel fixierbar. Die Fingerbewegung erfolgte über eine Zugkonstruktion mit Lederriemen auf der Oberseite der Prothese. Diese einfachere Prothesenform war preislich erschwinglicher als die komplexen Sauerbruchprothesen und ohne zusätzliche Operation anwendbar. Durch sie ließ sich das Leben des Invaliden auch kostengünstig deutlich verbessern.
Das Exponat ist eine Leihgabe des Naturhistorischen Museums Wien.
Objektinfos
Bezeichnung
- Datierung nach 1922
- Epochenraum Weimarer Republik
- Kategorie Medizin
- Herkunft Deutschland
- Dimensionen 9 x 8 x 31 cm (BxHxT)
- Material Gummi, Holz, Leder, Metall, Stoff
Objektinfos
Bezeichnung
- Datierung nach 1922
- Epochenraum Weimarer Republik
- Kategorie Medizin
- Herkunft Deutschland
- Dimensionen 9 x 8 x 31 cm (BxHxT)
- Material Gummi, Holz, Leder, Metall, Stoff

Über das Deutschlandmuseum
Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte
Lesetipps und Links
Lebensretter? Der Deutsche Stahlhelm im Ersten Weltkrieg
Deutsches Panzermuseum Munster
Lebensretter? Der Deutsche Stahlhelm im Ersten Weltkrieg
Deutsches Panzermuseum Munster
Artikel teilen
Weitere Objekte dieser Sammlung
Geschichte erleben

Besuche das einzigartige Deutschlandmuseum und tauche ein in die Geschichte
2000 Jahre
12 Epochen
1 Stunde